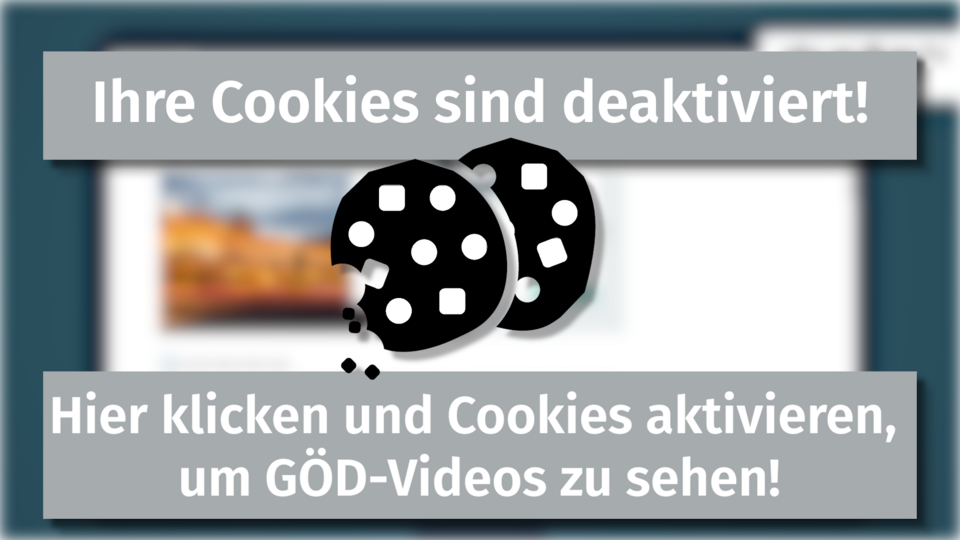Positionen und Ziele
Dafür stehen wir, dafür setzen wir uns ein.

Der Leitantrag zum außerordentlichen GÖD-Bundeskongress 2023 beinhaltet einige Positionen, für die sich die GÖD im Sinne aller öffentlich Bediensteten einsetzt.
Europa
Die Europäischen Union hat den an ihr teilhabenden Staaten die längste Zeit des Friedens in der gesamten Menschheitsgeschichte beschert. Allein diese Vermeidung von unvorstellbarem Leid ist nicht hoch genug einzuschätzen. Hinzu kommt der enorme Zuwachs an Wohlstand und sozialer Sicherheit, um die uns fast alle Regionen der Erde beneiden.
Die politische und wirtschaftliche Verflechtung macht Prozesse oft mühsam und schwerfällig. Eine Vereinbarungs- und Verhandlungskultur und die Sicherstellung der Rechtsstaatlichkeit sind aber das Fundament für eine erfolgreiche Friedensunion.
Die GÖD bekennt sich zur Europäischen Union. Die EU als Friedensprojekt, die Ökosoziale Marktwirtschaft und ein Europäisches Sozialmodell mit höchsten Sozialstandards sind auszubauen, und ihr Nutzen ist den EU-Bürger:innen deutlich stärker vor Augen zu führen.
Starker demokratischer Staat mit starkem Öffentlichen Dienst
Österreich hat einen hervorragenden Öffentlichen Dienst. Bestens ausgebildete, hoch motivierte Kolleg:innen erbringen Leistungen in Spitzenqualität, was nicht nur den hier lebenden Menschen direkt nützt, sondern auch einen großen Standortvorteil bei Betriebsansiedlungen darstellt.
„Eine funktionierende Verwaltung, ein unbestechliches rechtsstaatliches Justizwesen, eine vernünftige und ausgewogene Sicherheitspolitik, ein funktionierendes und den Prinzipien der europäischen Aufklärung verpflichtetes Bildungswesen machen diese Gesellschaft noch nicht zu einem Paradies – aber sie sind eine unverzichtbare Voraussetzung für ein besseres Leben.“ So drückte es Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann in seiner Festrede am 13. Oktober 2016 auf dem 17. GÖD-Bundeskongress aus. Ein starker Öffentlicher Dienst trägt zum sozialen Frieden und zur Wohlfahrt bei.
Klimaschutz
Die Mitwirkung des Öffentlichen Dienstes an der Erreichung der globalen Klimaziele ist sicherzustellen und verstärkt in Angriff zu nehmen.
Ein klima- und umweltschutzgerechter Strukturwandel unter Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmer:innen ist sicherzustellen.
Sozialpartnerschaft
Die letzten Jahre haben unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt: Finanz- und Wirtschaftskrise, Migrations- und Flüchtlingsbewegung, COVID-19-Pandemie, Klimakrise … Eine Verhandlungs- und Vereinbarungskultur im Interesse des Staatsganzen, gelebte Sozialpartnerschaft, ist in einem solchen Szenario wichtiger denn je.
Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) kommt in einer Studie zum Ergebnis, dass Staaten mit sozialpartnerschaftlichen Strukturen wirtschaftlich gesehen besser durch die Finanzkrise 2008 gekommen sind. Die Sozialpartnerschaft ist ein Erfolgskonzept! Sozialpartnerschaft kann allerdings nur funktionieren, wenn sie von beiden Seiten gelebt wird.
Alle, die die Sozialpartnerschaft zu Grabe tragen oder schwächen wollen, haben anscheinend aus der Geschichte nichts gelernt, das System nicht verstanden oder äußerst egoistische Motive.
Die GÖD fordert: Veränderungen sind von Dienstgeber- und Dienstnehmerseite gemeinsam zu gestalten. Nur ein gemeinsam beschrittener Weg führt zu Zielen, die im Interesse aller liegen.
Personal und Ressourcen
Der Arbeitsdruck und die Arbeitsverdichtung sind in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes in den letzten Jahren weiter angestiegen. Immer wieder werden verwaltungsintensive Gesetze beschlossen, ohne die für die Umsetzung notwendigen Personalressourcen zur Verfügung zu stellen. Wegen der Einsparungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, ja Jahrzehnte, sind allerdings keine Personalreserven mehr vorhanden.
Oftmals wird der Mythos vom überbordenden Öffentlichen Dienst genährt, um Einsparungen rechtfertigen zu können. Tatsache ist jedoch, dass der Anteil öffentlich Bediensteter an der Erwerbsbevölkerung in Österreich deutlich unter dem OECD-Schnitt liegt. Wir könnten rund 10 % mehr Menschen im öffentlichen Bereich beschäftigen, um den OECD-Durchschnittswert zu erreichen. Und in den skandinavischen Ländern, die ja nicht gerade zu den Armenhäusern der Erde zählen, ist der Anteil bis zu 80 % über dem in Österreich.
Das Durchschnittsalter im Bundesdienst liegt aktuell bei 45,3 Jahren und damit fast sechs Jahre über dem der Privatwirtschaft. Bis 2034 werden rund 45 % des bestehenden Personals aufgrund ihres Alters aus dem Dienst ausscheiden. Da die Qualifikation der Mitarbeiter:innen im Öffentlichen Dienst im Schnitt deutlich höher ist als in der Privatwirtschaft, ist eine vorausschauende Personalpolitik doppelt wichtig, um die notwendige Zahl an qualifizierten Personen für den Öffentlichen Dienst zu gewinnen und den Wissenstransfer garantieren zu können.
Schon jetzt arbeiten die Kolleg:innen an der Belastungsgrenze und oft darüber hinaus. Überforderung, Erschöpfung, Depressionen, Burnout etc. sind die Folgen. Die jahrzehntelange Politik der Umsetzung eines möglichst schlanken Staates ist gescheitert.
Damit die hohe Qualität der Leistungen des Öffentlichen Dienstes erhalten werden kann, sind Personal- und Sachressourcen rechtzeitig zu planen und in ausreichendem Maß zur Verfügung zu stellen. An einer Reform, deren Ziel die spürbare Entlastung der Kolleg:innen ist, beteiligt sich die GÖD gerne. Personalmaßnahmen dürfen nicht erst dann gesetzt werden, wenn es bereits zu spät ist.
Die GÖD fordert umgehend Maßnahmen, um die Kolleg:innen zu entlasten und die Personalsituation nachhaltig zu verbessern. Prekäre Dienstverhältnisse sind in angemessen bezahlte Dauerstellen umzuwandeln. Die Expertise der Bediensteten ist zu nutzen und der Zukauf externer Expertise zu reduzieren.
Zur Gewährleistung des Wissenstransfers sollen Neuanstellungen bereits einige Zeit vor dem altersbedingten Ausscheiden von Kolleg:innen erfolgen.
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sind nicht nur den hier lebenden Menschen ein großes Anliegen, sie sind auch ein Fundament für Demokratie, Freiheit und wirtschaftliche Entwicklung.
Österreich kann stolz auf die Leistungen in diesen Bereichen sein, die durch den hohen persönlichen Einsatz der Kolleg:innen im Exekutivdienst, beim Bundesheer und in der Justiz gewährleistet werden. Die Politik hat nicht nur die dafür notwendigen Personal- und Sachressourcen zur Verfügung zu stellen, sondern auch das Vertrauen in die Institutionen zu stärken.
Ein bereits in vielen Regierungsprogrammen angekündigtes neues Dienstrecht muss mit einer öffentlich-rechtlichen Ausrichtung sicherstellen, dass die Kolleg:innen bei der Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben vor willkürlicher Einflussnahme geschützt sind.
Übergriffe dürfen nicht bagatellisiert werden. Gewalt- und Mobbingprävention müssen weiter vorangetrieben werden. Durch entsprechende strafrechtliche Regelungen ist klarzumachen, dass die Gesamtgesellschaft hinter jenen Kolleg:innen steht, die für unsere Sicherheit sorgen. Außerdem hat der Dienstgeber alle möglichen Schutzmaßnahmen zu treffen, um das Wohl der Bediensteten sicherzustellen.
Frauen- und Familienpolitik
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Wettbewerb um hoch qualifizierte Mitarbeiter:innen in den nächsten zehn Jahren stetig steigen. Der Öffentliche Dienst hat die Chance, durch ein besonders frauen- und familienfreundliches Umfeld die Personallücke mit hoch qualifizierten Personen zu schließen. Dazu muss auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer noch mehr als bisher Rücksicht genommen werden.
Schwangerschaft und Karenz dürfen nicht nur de iure, sondern auch de facto zu keinem Nachteil für die Bediensteten führen. Die Umsetzung der Frauenförderungspläne ist weiter voranzutreiben, um den Frauenanteil in Führungsfunktionen zu erhöhen. Seit 2006 ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen zwar auf allen Ebenen angestiegen, liegt aber dennoch erst bei 37,5 %.
Die GÖD fordert daher u. a.
- bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten in Hinblick auf Vordienstzeiten, die Pension bzw. den Ruhebezug
- Verbesserungen bei der Pflegefreistellung
- mehr qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungsangebote, die auch Personen mit Betreuungspflichten leichter zugänglich sind
- alternsgerechte Arbeitsplätze
- positive Anreize für die Übernahme von Familienarbeit durch Männer
- Ausbau der alters- und gendergerechten Medizin etc.
Dienst- und Besoldungsrecht
Die GÖD fordert die schon in vielen Regierungsprogrammen angekündigte Schaffung eines neuen Dienst- und Besoldungsrechts für den Bundesdienst.
Der Öffentliche Dienst ist gemeinwohlorientiert. Das bedeutet insbesondere die Sicherstellung von Rechtsstaatlichkeit, den gleichen Zugang aller Bürger:innen zu den Leistungen des Öffentlichen Dienstes, Überparteilichkeit und einen unparteiischen Gesetzesvollzug.
Die Gemeinwohlorientierung steht einer Gewinnorientierung diametral gegenüber. Daher ist ein eigenständiges Dienstrecht für öffentlich Bedienstete mit einer öffentlich-rechtlichen Grundausrichtung unabdingbar. Berufsspezifische Besonderheiten müssen entsprechend berücksichtigt werden.
Ein einheitliches Dienstrecht auf Bundesebene bedeutet für Vertragsbedienstete und für Beamt:innen im Wesentlichen eine gleiche dienstrechtliche Basis sowie eine gleiche Besoldung (inkl. Mitarbeitervorsorge- und Pensionskasse).
Eine Besoldungsreform muss integraler Bestandteil eines neuen Dienstrechts sein und soll dazu führen, dass der öffentliche Dienstgeber am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig bleibt. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen:
- Einstufung nach dem Verwendungsprinzip (Arbeitsplatzbeschreibung)
- vollständige Anrechnung der für die jeweilige Verwendung einschlägigen (berufsrelevanten) Vordienstzeiten, um auch berufserfahrene Kolleg:innen aus der Privatwirtschaft zu gewinnen
- Definition von Normverläufen entsprechend einem Referenzstellenmodell
- Förderung der Mobilität zwischen den Gebietskörperschaften
- Integration mancher Zulagen in den Grundbezug (Leistungsbezogene Zulagen wie etwa Gefahrenzulage, Erschwerniszulage etc. bleiben gesondert bestehen.) • besoldungs- und pensionsrechtliche Gleichstellung von Beamt:innen und Vertragsbediensteten
- Geltung für Neueintretende
- unbefristetes Optionsrecht für bereits im Dienst befindliche Kolleg:innen
Ein modernes Reisegebührenrecht ist ebenfalls umzusetzen.
Sowohl in den vertraglichen als auch in den öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen sind besondere Schutzmechanismen wie etwa ein besonderer Kündigungsschutz vorzusehen. Diesem hohen Bestandsschutz des Dienstverhältnisses steht eine besondere Treuepflicht der Bediensteten gegenüber. Deshalb sollen sowohl Vertragsbedienstete als auch Beamt:innen einem Disziplinarrecht unterliegen.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie andere familienfreundliche Regelungen sind beizubehalten bzw. auszubauen. Hier soll die Vorbildrolle des öffentlichen Dienstgebers gestärkt werden.
Der Arbeitnehmer:innenschutz ist weiter zu verbessern. Es muss außerdem sichergestellt werden, dass die Einführung von (fehlenden) Schutzmaßnahmen wie in der Privatwirtschaft auch durchgesetzt werden kann.
Bis zur Einführung eines solchen neuen Dienst- und Besoldungsrechts ist das bestehende Dienst- und Besoldungsrecht weiterzuentwickeln, um die Rahmenbedingungen für öffentlich Bedienstete zu verbessern und die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes zu erhöhen, was auch in Hinblick auf den demografisch bedingten enormen Personalbedarf in naher Zukunft von entscheidender Bedeutung ist. Die GÖD fordert daher – unabhängig von der Einführung eines neuen Dienst- und Besoldungsrechts – u. a.
- mehr freie Zeit für eine vernünftige Work-Life-Balance
- Altersteilzeit- und Gleitpensionsmodelle
- Schaffung der Möglichkeit eines Sabbaticals für alle öffentlich Bediensteten
- Verbesserung der Pflegefreistellung
- freiwilliges Zeitkontomodell für alle Berufsgruppen
- Reisezeit als Dienstzeit
- verstärkter Schutz bei Struktur- und Organisationsanpassungen
- alternsgerechte Arbeitsbedingungen
- Ausbau des Gesundheitsschutzes und Verbesserung der Möglichkeiten des Arbeitsplatzwechsels innerhalb des Öffentlichen Dienstes („Ausstiegsszenarien“)
- Weiterbeschäftigungsgarantie für schwangere Kolleg:innen (auch um den Bezug aller Varianten von Kinderbetreuungsgeld zu gewährleisten)
- kein automatisches Enden des Dienstverhältnisses von Vertragsbediensteten nach einem Jahr Krankheit
- stärkere Förderungsmaßnahmen für beeinträchtigte Personen und Ausbau der Barrierefreiheit
- mehr qualitativ hochwertige Fort- und Weiterbildungsangebote
- Berücksichtigung neuer Berufsbilder in den Richtverwendungen
- Erhalt und Ausbau dezentraler Arbeitsplätze
- zusätzliche Einstellungen anstelle der Nutzung von Leiharbeiter:innen
- Laufbahnstellen auf Basis verpflichtender und transparenter Personalentwicklungspläne an den Universitäten und Beseitigung von prekären Arbeitsverhältnissen
- mehr Freistellungen für Personalvertretungs- und Betriebsratsorgane
- Bildungsfreistellung auch für Ersatzmitglieder von Personalvertretungs- und Gewerkschaftsorganen
- Sanktionsmöglichkeiten beim Bruch des Personalvertretungsgesetzes
- Attraktivierung der Gehaltsstaffeln
- verbesserte Anrechnung von Vordienstzeiten
- Bezahlung entsprechend Verwendung auch bei Beamt:innen
- Angleichung der Bezüge von Vertragsbediensteten und Beamt:innen auf das jeweils höhere Niveau
- Auch Personen in Leitungsfunktionen sind mit steigender Arbeitsbelastung aufgrund ständig wachsender Anforderungen und Erwartungen konfrontiert. Die Zahl der Bewerbungen für Leitungsfunktionen nimmt kontinuierlich ab. Wir fordern daher dringend eine Neubewertung und Attraktivierung der Leitungsfunktionen.
- Einarbeitung pauschalierter Zulagen in den Grundbezug (Leistungsbezogene Zulagen wie etwa Gefahrenzulage, Erschwerniszulage etc. müssen gesondert bestehen bleiben.)
- Erhöhung der Zulagen für Arbeit unter erschwerten Bedingungen (z. B. Nacht-, Wochenendund Feiertagsdienste, Rufbereitschaft, Gefahren)
- Abfertigung auch für Beamt:innen (je nach Ausmaß der Betroffenheit durch die „Pensionsharmonisierung“) und bei einvernehmlicher Auflösung des Dienstverhältnisses
- Abgeltung für Präventivkräfte (z. B. Brandschutz- und Sicherheitsbeauftragte)
- besoldungsgruppenübergreifende Verwendungszulagen
- Belohnungen und Jubiläumszuwendung wahlweise als Geldleistung oder Zeitausgleich
- höhere Pensionen bzw. Ruhebezüge bei dauernder Dienstunfähigkeit/Berufsunfähigkeit, Schwerarbeit und langen Beitragszeiten
- Anpassung der Schwerarbeitsregelung (Aufnahme von Justizwachebediensteten; Adaptionen, sodass formale Probleme etwa für Bedienstete im Gesundheitsbereich und im Straßendienst beseitigt werden)
- Anerkennung von Präsenz- und Zivildienstzeiten und Zeiten des Freiwilligen Sozialen Jahres für den Frühstarterbonus
- Abschaffung des „Pensionssicherungsbeitrags“
- Pensionsanpassung nach dem Mikrowarenkorb auch für höhere Pensionen und Ruhebezüge
- automatische Valorisierung aller Reisegebühren
- bessere steuerliche Absetzbarkeit von Arbeitsbereich und Arbeitsmitteln – auch für Arbeitnehmervertreter:innen
- Erhöhung der Freibeträge gem. § 67 (sonstige Bezüge) und § 68 EStG (Schmutz-, Gefahrenzulage etc.; steuerfreier Überstundenzuschlag)
- Erhöhung der steuerlichen Anreize für die private Pensionsvorsorge (z. B. § 3 Abs. 1 Z 15 EStG – Zukunftssicherung, § 108a EStG – prämienbegünstigte Pensionsvorsorge)
- Evaluierung der gesetzlichen Grundlagen für Naturalwohnungen, insbesondere im Steuerrecht
- Steuerfreiheit für Abgeltung von Mehrarbeit in Krisen- und Katastrophenfällen
Soziale Sicherungssysteme
Das österreichische Gesundheitssystem wird international als vorbildlich eingestuft. Alle Kolleg:innen, die das österreichische Gesundheitssystem tragen, leisten höchst motiviert Arbeit in Topqualität, was sich zuletzt wieder in der Corona-Pandemie gezeigt hat. Es hat sich dabei allerdings auch gezeigt, dass weit über die Belastungsgrenze hinaus gearbeitet werden musste. Wir benötigen dringend eine Anpassung des geltenden Dienst- und Besoldungsrechts.
Die Leistungen im Gesundheitssystem haben sich am aktuellen Stand der Wissenschaft und Forschung zu orientieren. Qualität ist nicht verhandelbar und darf nicht durch finanzielle Vorgaben eingeschränkt werden. Die dafür erforderlichen Ressourcen sind zur Verfügung zu stellen. Der freie und uneingeschränkte Zugang zu den Leistungen der Medizin und der sozialen Betreuung muss für alle Bürger:innen gesichert sein.
Das österreichische Gesundheitswesen ist unter Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung als wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge auszubauen und vor Privatisierungstendenzen zu schützen. Im Gesundheitsbereich gibt es für die Politik drei zentrale Handlungsbereiche: Personalbemessung, Arbeitsbedingungen und Ausbildung. Die GÖD fordert
- Erstellung eines österreichweit verbindlichen, transparenten und bedarfsorientierten Personalbemessungsmodells
- Planbarkeit und Verlässlichkeit der Arbeitszeit
- attraktive und qualitativ hochwertige Ausbildungswege mit finanziellen Anreizen
Das österreichische Pensionssystem ist solidarisch organisiert und krisensicher. Die gesetzliche Pensionsversicherung hat seit ihrer Einführung die Lebensstandardsicherung als Ziel. Die Umlagefinanzierung sorgt für die nötige Stabilität. Die immer wiederkehrende Panikmache ist fehl am Platz und unseriös. Sowohl die gesetzlichen Pensionen als auch die öffentlich-rechtlichen Ruhebezüge sind auch in Zukunft finanzierbar. Eine lebensstandardsichernde Altersversorgung in der ersten Säule ist beizubehalten.
Allerdings ist das System weiterzuentwickeln. Attraktive Gleitpensions- und Altersteilzeitmodelle sind zu schaffen bzw. auszubauen, um für die Bediensteten gegen Ende der Berufslaufbahn eine alternsgerechte Perspektive zu schaffen.
Im öffentlich-rechtlichen Pensionssystem ist der sog. „Pensionssicherungsbeitrag“ abzuschaffen. Diese Regelung ist ungerecht und vor dem Hintergrund der zahlreichen Pensionsreformen in der Vergangenheit nicht mehr rechtfertigbar.
Die Dienstgeberbeiträge in die Bundespensionskasse sind auf ein in Kollektivverträgen übliches Ausmaß anzuheben.
Bildung
Ein vielfältiges Bildungssystem soll den unterschiedlichen Interessen, Neigungen und Fähigkeiten unserer Kinder und Jugendlichen gerecht werden, diese optimal fördern und unter dem Motto „Kein Abschluss ohne Anschluss“ durchlässig sein.
Zur erfolgreichen Bewältigung gestellter Aufgaben und Ziele bedarf es in allen Bereichen – im elementarpädagogischen und im schulischen – entsprechend guter Rahmenbedingungen. Neben einer modernen Infrastruktur benötigen Lehrer:innen auch geeignete Werkzeuge und Mittel, um ihre gesetzlichen Aufträge – Wissensvermittlung und Erziehung – erfüllen zu können.
Die Zeit ist reif für eine Besinnung auf den hohen Stellenwert aller unserer Schularten. Diese Einsicht muss in ein klares Bekenntnis zur hohen Professionalität und Expertise der österreichischen Lehrer:innen und zu entsprechenden Investitionen in allen pädagogischen und organisatorischen Bereichen der einzelnen Schularten münden.
Die Beherrschung der Unterrichtssprache ist Voraussetzung für den Bildungserwerb. Kinder und Jugendliche müssen das der jeweiligen Schulstufe entsprechende Kompetenzniveau in der Unterrichtssprache aufweisen, um dem Unterricht folgen zu können. Ist dieses nicht vorhanden, haben sie so lange altersgerechte Sprachförderung zu erhalten, bis sie die erforderlichen Sprachkenntnisse lt. Expertise der Pädagog:innen erworben haben. Besonders wichtig sind hier auch Angebote der vorschulischen Sprachförderung im Bereich der Frühkind- und Elementarpädagogik.
Jede einzelne Schulart bietet unseren Kindern und Jugendlichen ganz spezifische Möglichkeiten und Perspektiven. Ständige Diskussionen über schulorganisatorische Änderungen bis hin zur Abschaffung einzelner Schularten (Sonderschulen, Polytechnische Schulen, Gymnasien) sind kontraproduktiv und schaden dem Vertrauen in unser gutes Schulsystem.
Die GÖD fordert daher u. a.
- Elementarpädagog:innen und Lehrer:innen als Expert:innen der Praxis müssen bei allen Überlegungen zur Weiterentwicklung unseres Bildungssystems von Beginn an einbezogen werden.
- Es müssen ausreichend Lehrer:innen eingestellt werden, um schulautonome Schwerpunktsetzungen vornehmen und ein vernünftiges Ausmaß an Förderangeboten (zur Vorbeugung von Defiziten, zur Defizitkompensation und zur Begabungs- und Talenteförderung) anbieten zu können.
- Österreichs Schulen brauchen professionelles Unterstützungspersonal im pädagogischen und administrativen Bereich in einem Ausmaß, das zumindest dem Durchschnitt der OECD-Länder entspricht.
- Lehrer:innen sind bei ihren erzieherischen Aufgaben durch praxisgerechte Modelle und wirksame Maßnahmen zu unterstützen. Praxisorientierte Fort- und Weiterbildung ist auszubauen.
- Das 2013 ohne sozialpartnerschaftliche Einigung beschlossene neue Lehrerdienstrecht muss überarbeitet und sozialpartnerschaftlich weiterentwickelt werden.
- Die dienst- und besoldungsrechtlichen Rahmenbedingungen für Erzieher:innen sind nachhaltig zu verbessern.
- Der derzeit bestehende 2,7 %-Deckel (FAG) für Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist aufzuheben und den realen Gegebenheiten anzupassen.
- Der „Arbeitsplatz Schule“ muss für Schüler:innen, Lehrer:innen und Verwaltungspersonal so adaptiert werden, dass er den heutigen Ansprüchen (inkl. Arbeitnehmer:innenschutz) entspricht.
- Ein weiterer Ausbau ganztägiger Schulformen auf freiwilliger Basis unter strikter Berücksichtigung qualitativ hochwertiger organisatorischer, pädagogischer und räumlicher Rahmenbedingungen für Schüler:innen, deren Eltern und Lehrer:innen ist vorzusehen.
Kollektivvertrag und Arbeitsverfassung
Die GÖD ist der zuständige Sozialpartner aller Arbeitnehmer:innen der ausgegliederten Dienststellen und neu geschaffenen Betriebe, die entweder von Organen des Bundes oder der Länder verwaltet werden oder unter deren überwiegendem wirtschaftlichen Einfluss stehen.
Die GÖD fordert insbesondere
- gesetzliche Verankerung der Kollektivvertragsfähigkeit für jede ausgegliederte Einrichtung
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel durch die öffentliche Hand für die Schaffung attraktiver Gehaltsmodelle für Betriebe in ausgegliederten Bereichen
- Ausweitung der Kompetenzen des Kollegialorgans Betriebsrat unter gleichzeitiger Ausweitung der auf die Mandatare und Ersatzmitglieder anzuwendenden Schutzbestimmungen
- Bildungsfreistellung auch für Betriebsratsersatzmitglieder
- drittelparitätische Besetzung mit GÖD- und Betriebsratsmitgliedern in unternehmerischen Aufsichtsgremien der ausgegliederten Bereiche
- vollumfängliches Stimmrecht für Betriebsräte im Universitätsrat
- Verbesserung der Briefwahl nach der Arbeitsverfassung im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl
Digitalisierung
Digitalisierung macht vor dem Öffentlichen Dienst nicht halt. Die Mitwirkungsrechte der Personalvertretung sowie der Betriebsratsorgane sind an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Das Recht, offline zu sein, muss verbindlich verankert werden.
Computerprogramme und Roboter, seien sie auch noch so ausgeklügelt, können keine ethischen Fragen beantworten. Jedes System und jede Technik müssen zum Wohle aller gestaltet sein und allen Menschen dienen – und nicht umgekehrt.
Aus- und Weiterbildung wird in Zukunft noch wichtiger als in der Vergangenheit. Die diesbezüglichen Möglichkeiten sind auszubauen und zu verbessern.
In Zukunft wird immer mehr Arbeit von Computern, computergesteuerten Maschinen, Robotern und Softwareprogrammen erledigt werden. Vor diesem Hintergrund muss einerseits über die Verteilung der Arbeitszeit neu diskutiert werden. Andererseits sind die sozialen Sicherungssysteme auf eine breitere finanzielle Basis zu stellen. Die derzeit an den Faktor menschliche Arbeit geknüpfte Finanzierung reicht nicht aus. Außerhalb Europas produzierende Konzerne müssen für Umsätze in Europa einen fairen Beitrag zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme leisten.
Die Digitalisierung führt auch in der öffentlichen Verwaltung zu Umbrüchen. Doch in jeder Veränderung liegt auch eine Chance. Unter Einbeziehung der Personalvertretung und Gewerkschaft ist dieser Transformationsprozess so zu gestalten, dass sowohl die Bürger:innen als auch die öffentlich Bediensteten davon profitieren. Und eines ist unabdingbar: Der Mensch muss im Mittelpunkt all dieser Entwicklungen stehen.